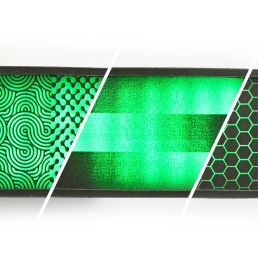Batteriegehäuse aus Naturfaser-Organoblechen
Leichtbau mit Flachsfaser verstärkten Bauteilen
6. Juli 2022
Für Leichtbauanwendungen mit besonderen Anforderungen und mit dem Wunsch zur Verwendung nachwachsender Rohstoffe kommen zunehmend Naturfasern wie Flachs in Frage. Am Fraunhofer LBF wurden in Kooperation mit der Ansmann AG, einem Produzenten von Lithium-Ionen-Batterien, im Forschungsprojekt „Biobattery“, Organobleche zur Verstärkung von Batteriegehäusen aus Flachsfasern entwickelt.
Organobleche ersetzen klassische Blechbauteile
Unter Organoblechen versteht man flache, blechartigen Bauteile, die aus einem Verbund von Fasern und einer thermoplastischen Bindung erzeugt werden. Ihr Eigenschaftsprofil ist mit dem metallischer Bleche vergleichbar.
Bislang sind Organobleche mit Naturfasern selten in der industriellen Fertigung zu finden. Dies liegt zum einen an der Empfindlichkeit der Fasern bei hohen Temperaturen. Zum anderen fehlten bislang kontinuierliche Massenproduktionsverfahren.
Am Fraunhofer LBF haben Wissenschaftler daher ein Schmelzimprägnierverfahren so weiterentwickelt, dass Naturfasern für eine kontinuierlichen Herstellung von Organoblechen genutzt werden können. Dabei kommen Flachsfasern mit im Vergleich zu anderen Naturfasern erhöhter thermischer Stabilität zum Einsatz, die in eine Matrix aus Polypropylen eingebracht werden.
Als Alternative wurde im Projekt „Biobattery“ auch das biobasierte Polyamid PA11 als Matrixmaterial mit verbessertem mechanischem Eigenschaftsprofil qualifiziert. Neben den thermischen Nachteilen zeichnen sich Naturfasern wie Flachs oder Hanf vor allem durch ihre geringe Splitterneigung und eine hohe Elastizität aus.
Daher würden die entwickelten Organobleche vor allem das Crashverhalten von Elektrofahrzeugen verbessern und die Bruchneigung der Batteriegehäuse vermindern. Zu Demonstrationszwecken wurde eine Lösung aus Flachs-PP-Organoblechen für ein Batteriegehäuse eines Elektrofahrrads präsentiert.
Die Verbindung der Organobleche mit dem Gehäuse wurde im Spritzguss erzeugt. Dabei wurde zwar eine leichte Krümmung der hergestellten Bauteile beobachtet, jedoch gehen die Wissenschaftler von einer baldigen industriellen Verfügbarkeit des Verfahrens aus.
Das Vorhaben wurde vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) über den Projektträger Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR) gefördert. Den Abschlussbericht findet man unter: www.fnr.de/projektfoerderung/projektdatenbank-der-fnr
www.lbf.fraunhofer.de/de/projekte/leichtbau-biobasierte-kunststoffe.html
Bilderquelle: Ansmann
Seastex Akustikfliesen
2. Mai 2024
Sander Nevejans hat mit seinem Unternehmen Seastex eine Fasertechnologie…
Naturfaserverstärkter Autositz
22. Oktober 2023
Im Mittelpunkt des Projekts "Design for Recycling" steht eine Sitzschale, die…
Tellur-freie thermoelektrische Generatoren
24. Mai 2024
Am Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden wurde ein…
3D-druckbares Quarzglas für Hochleistungsanwendungen
12. April 2023
Die auf den 3D-Druck keramischer Hochpräzisionsbauteile spezialisierte Lithoz…
Transluzentes 3D-Druckmaterial
17. Juni 2024
Mit einem 3D-Druckverfahren ist es am Fraunhofer IPA gelungen, hinterleuchtete…
Transversalfluss-Maschine und Reluktanzmotor
16. Oktober 2023
Zu den "Future Mobility Open Labs" am 5. Oktober in Karlsruhe wurde das…
Emotionalität humanoider Roboter
17. Juli 2024
In seiner Masterthesis hat Niko Alber eine Installation eines lebensgroßen…
Eisbär Strickpullover aus Aerogelgarn
5. März 2024
Forscher der Zhejiang Universität in Hangzhou präsentierten jüngst einen…
Smart Ring
27. Februar 2024
Durch Miniaturisierung von Sensorik und Antenne in einen Ring haben Start-Ups…